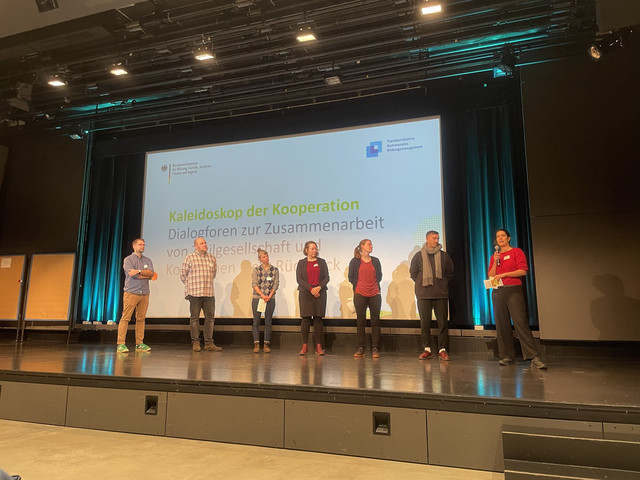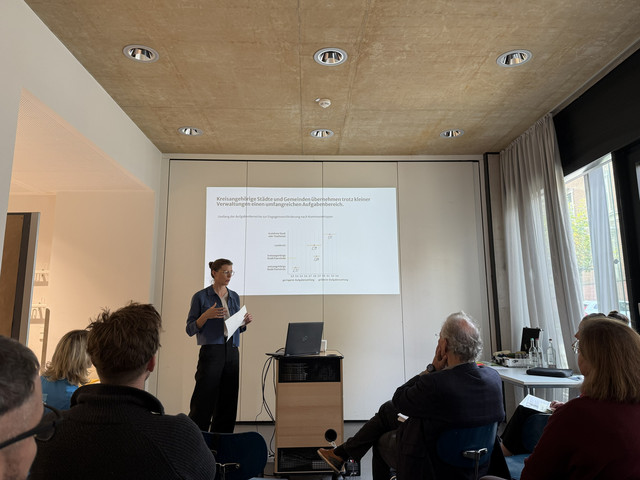Zivilgesellschaft und Kommune: Gemeinsam Bildungslandschaften gestalten
Wie Kooperationen zwischen Kommune und Zivilgesellschaft für zukunftsfähige Bildungslandschaften gestärkt werden können, stand im Zentrum der Fachkonferenz der Transferinitiative kommunales Bildungsmanagement am 5. und 6. November 2025 in Bonn. „Gute Bildung entsteht dort, wo Kommune und Zivilgesellschaft an einem Strang ziehen.“ Mit diesen Worten eröffnete Dr. Andrea Ruyter-Petznek, Referatsleiterin im Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) die Fachkonferenz. Über 250 Akteur*innen aus Kommunalverwaltungen, Bildungsinstitutionen und zivilgesellschaftlichen Organisationen diskutierten aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Optionen für ein wirksames kommunales Bildungsmanagement. Deutlich wurde: Zukunftsfähige Bildungslandschaften entfalten ihr Potenzial, wenn Bildungsakteure, Verwaltung und Zivilgesellschaft auf Augenhöhe zusammenarbeiten, Engagement vor Ort gefördert und gezielt lokale Netzwerke gestärkt werden.
Dialog und Transfer im Fokus
Das zweitägige Programm der Fachkonferenz beleuchtete die vielen Facetten der Kooperationen zwischen Zivilgesellschaft und Kommune und setzte sie in den Kontext des Förderprogramms „Bildungskommunen“. Neben zwei Podiumsdiskussionen mit Vertreter*innen aus Politik, Wissenschaft, Kommune und Zivilgesellschaft, wurden auch zahlreiche Praxisbeispiele im Plenum vorgestellt, darunter Projekte zu lokalen Bildungsnetzwerken, Begegnungsorten im Sozialraum oder Sprachförderung durch Lesementor*innen. Jeweils sieben Dialogforen und Transfer-Workshops boten Raum für Austausch und stellten transferfähige Praxis in den Vordergrund. Die REAB Hessen war im Rahmen der Konferenz mit mehreren Beiträgen vertreten:
Dialogforum 6: „Wo Bildung ankommt – Kooperationen an Dritten Orten stärken“
Gemeinsam mit Monika Ripperger, Leiterin Stabsstelle Pädagogische Grundsatzplanung der Stadt Frankfurt am Main, diskutierten Nadine Rondeau und Sophija Savtchouk über die Bedeutung „Dritter Orte“ für kommunale Bildungslandschaften und darüber, wie diese im Bildungskontext gestaltet werden können. Die vorgestellten Frankfurter Stadtteil-Labore zeigen, wie niedrigschwellige Beteiligungsformate direkt im Quartier wertvolle Einblicke in Bildungsbedarfe ermöglichen, Lösungsprozesse unterstützen und Bildung wie auch Beteiligung als kontinuierlichen Dialog im Lebensumfeld der Bürger*innen verankern.
Transfer-Workshop 1: „KI als Werkzeug für Partizipation in kommunalen Bildungslandschaften“
Gemeinsam mit den REAB Nord, Bayern und NRW wurde hier erörtert, wie KI-gestützte Werkzeuge Kommunen bei der Vernetzung mit zivilgesellschaftlichen Bildungsakteuren, der Ansprache verschiedener Zielgruppen und der Gestaltung von Beteiligung unterstützen können. Deutlich wurde insbesondere, dass KI zwar bereits jetzt viele Prozesse in der kommunalen Bildungsarbeit verändert, jedoch keine Beziehungsarbeit oder Entscheidungsprozesse ersetzt.
Transfer-Workshop 3: „Zivilgesellschaftliches Engagement in kommunalen Bildungslandschaften stärken“
Im Transfer-Workshop 3, konzipiert und moderiert von Dr. Corinna Mühlig und Nadine Rondeau, standen strukturelle Voraussetzungen kommunaler Engagementförderung im Mittelpunkt. Hanna Kribbel (neuland21 e.V.) stellte zentrale Ergebnisse einer Studie vor, die verschiedenen Formen der Engagementorganisation identifiziert und typische Herausforderungen beschreibt, darunter unklare Finanzierungsgrundlagen, hoher Verwaltungsaufwand, knappe Ressourcen sowie fehlende Abstimmung zwischen Förderstrukturen. Anja Lothschütz und Kirsten Korte (Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e. V.) gaben praxisnahe Einblicke aus der Metropolregion Rhein-Neckar und zeigten auf, wie sektorübergreifende Zusammenarbeit Initiativen stärkt und regionale Lösungsprozesse ermöglicht. In einer anschließenden Arbeitsphase diskutierten die Teilnehmenden förderliche und hemmende Faktoren für Engagement in den Kommunen. Als Lösungsansätze wurden ein gemeinsames Leitbild, lokale Ansprechpersonen, stabile Netzwerke und die Wertschätzung des Ehrenamts besonders hervorgehoben.
Die ausführliche Dokumentation der Fachkonferenz ist auf der Website der Transferinitiative verfügbar.
Neue Publikation rückt Zivilgesellschaft als Bildungsakteurin in den Mittelpunkt
Im Rahmen der Konferenz wurde die gleichnamige Publikation der Transferinitiative vorgestellt. Sie zeigt zentrale Potenziale und Handlungsoptionen zivilgesellschaftlichen Engagements in kommunalen Bildungslandschaften auf und bietet nützliche Anregungen und Transferhinweise für Verwaltung, Bildungsakteure und Bildungsnutzende.
Die Publikation umfasst sieben thematische Kapitel, die ein breites Spektrum relevanter Handlungsfelder an der Schnittstelle von Kommune und Zivilgesellschaft abdecken. Sie arbeiten den Mehrwert und die Vielfalt zivilgesellschaftlichen Engagements in Bildungslandschaften heraus. Ziel ist es, die Potenziale zivilgesellschaftlicher Akteure und der Zusammenarbeit mit kommunalen Strukturen sichtbar zu machen. Daher bildet der Blick in die Praxis den Kern der Veröffentlichung. Die beleuchteten Praxisbeispiele reichen von sozialräumlichen Quartiersprojekten über die strukturelle Förderung von Engagement bis hin zu eng verwobenen Bildungspartnerschaften zur Bewältigung ortsspezifischer Herausforderungen.
Darüber hinaus liefern Beiträge aus dem Fachnetzwerk für Kommunales Bildungsmanagement Impulse für eine gelingende Zusammenarbeit vor Ort, die sich an Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Kommunen richten. Unter anderem setzt sich Thomas Verlage von der REAB Hessen mit Beteiligungsprozessen mittels digitaler Medien auseinander und thematisiert dabei auch zwei Erfolgsbeispiele aus Hessen: die Beteiligungsplattform der Stadt Frankfurt am Main „Frankfurt fragt mich“ und das digitale Kommentierungsverfahren zum Orientierungsrahmen für Bildungsentwicklung der Stadt Offenbach am Main. Im Interview mit Dr. Harald Seehausen, dem Vorstandsmitglied des Breitensportvereins SG Bornheim 1945 e. V. Grün-Weiss sowie Gründer und Leiter des Kinder- und Familienzentrums, findet Nadine Rondeau heraus, wie sein Sportverein spielend den Sozialraum gestaltet und Zukunftskompetenzen fördert.
Die Publikation ist als kostenloser Download auf der BMFSFJ-Website verfügbar.